„Sie sind Tanja Weber?! Wenn ich an Ihr zweites Buch denke, wird mir schlecht“, sagt die Programmleiterin und streckt mir ihre Hand zur Begrüßung hin.
Ich bin eingeladen, auf dem kleinen Tisch im Büro stehen drei Gläser und eine Flasche Wasser. Kein opulentes Mittagessen wie sonst, Nachtigall, ick hör dir trapsen.
Auf meine höfliche Nachfrage, was genau ihr Übelkeit versursacht, erklärt die mir bis dahin Unbekannte, dass ihr das Ende meines zweiten Romans nicht schmeckt. Auf weiteres Nachbohren stellt sich heraus, dass sie lediglich das bereits ein Jahr alte Exposé kennt, das fertige Manuskript aber, in dem das Ende in Absprache mit meiner Lektorin ein ganz anderes ist, nicht. Allerdings hatte ich dieses so rechtzeitig an den Verlag geschickt, dass man es durchaus hätte lesen können, schließlich sollte es die Grundlage für das Gespräch sein.
Der Termin verläuft entsprechend kurz, ich finde das nicht weiter tragisch, dann habe ich mehr Zeit in Berlin für meine Freunde, schließlich bin ich ja extra aus München angereist. Als meine Agentin und ich den Verlag verlassen, reicht ein Blick um sich zu verständigen: das war’s. Und zwar von unserer Seite, weitere Zusammenarbeit ausgeschlossen.
Ich hatte einen Krimi geschrieben, unter Pseudonym, der Erstling verkaufte sich aus dem Stand über 14.000 Mal – gar nicht übel, wie ich finde. Fast durchgängig positive Rezensionen, viele Lesungen und eine Filmoption machen das Buch für mich zum Erfolg. Warum also mit einem Verlag weiterarbeiten, der das so ganz anders sieht?
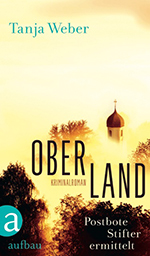
Da es ein Zweibuchvertrag ist, erscheint der übelkeitsverursachende zweite Teil zwar noch in dem Haus, wird aber naturgemäß marketingmäßig völlig vernachlässigt und verkauft sich nur noch halb so oft wie der erste. Wie auch anders, hat ja kaum jemand mitbekommen, dass das Buch erschienen ist.
Mich tangiert das erst einmal nicht weiter, ich bin gut beschäftigt, habe einen Vierbuch-Vertrag in einem anderen, ganz wunderbaren Verlagshaus. Dort wird den Leuten nicht schlecht, wenn sie an mich denken – alles passt.
Irgendwann aber, ich toure immer noch mit den beiden Krimis, muss ich mich der Frage stellen, ob ich damit doch irgendwann mal weitermache oder das Projekt begrabe. Die Filmfirma ist zuversichtlich, hat bereits bekannte Schauspieler angefragt, die Lesungen sind immer ausverkauft und die Leser begeistert.
Also: zweiter Anlauf. Meine Agentin bietet das Projekt an, aber andere Verlage sind zögerlich. Eine bestehende Reihe in einem anderen Verlag fortsetzen? Schwierig. Das zweite Buch hat sich nur halb so viel verkauft wie der Erstling? Noch schwieriger. Von allen kommt das Angebot: die Reihe fortsetzen eher nicht, die Autorin kann aber gerne einem kompletten Relaunch unterzogen werden.
Da das nicht das ist, was ich möchte, lehne ich dankend ab. Und überlege, wie ich es anstellen könnte, zu schreiben, was ich will.
Selfpublishing ist die naheliegende Lösung. Schwärmen nicht die SPler immer von der großen Freiheit? Den horrenden Klickzahlen? Ein befreundeter Schriftsteller, ein „Hybrid-Autor“, rechnet mir vor, wie das Ganze bei einer 70%igen Beteiligung aussehen könnte. Wow! Das ist ja noch mehr als mein Vorschuss! Im Geiste bluten mir die Finger beim Scheinchenzählen.

Ich frage weiter herum. Meine Agentin zum Beispiel, die selbst einen E-Book-Verlag mit der Backlist ihrer Autoren führt, recht erfolgreich. Ihre Zahlen, selbst die guten, sind aber ganz andere. Sie rechnet Dienstleistungen heraus – Layout, Lektorat, Distribution, um nur das anzuführen, was ich verstanden habe. Der virtuelle Scheine-Stapel schmilzt wie Schnee in der Frühlingssonne. Dafür aber wächst die Aufzählung dessen, was ich für mein E-Book-SP-Debüt zu tun hätte. Social Media, Leserunden, die Blogger füttern und immer wieder: alles, was zählt ist das Ranking. Wie man das stabil oben hält? Social Media, Leserunden, Blogger füttern.
Und ganz klar: bei allem, was ich tun muss, gehe ich in Vorleistung.
Ich rechne. Wenn ich wirklich schnell bin, schaffe ich den Roman in drei bis vier Monaten. Danach die Werbe-Ochsentour. Erst mal für lau, ohne Garantie, ob ich jemals auch nur annähernd das erwirtschafte, was ich bräuchte, um vier Monate Umsonst-Arbeit zu rechtfertigen. Der kleine Haken an der Sache ist nämlich: Schreiben ist nicht mein Hobby, ich lebe davon. Und an mir hängt eine Familie, Mann und zwei Kinder. Und das mit dem unbekannten Erb-Onkel ist so eine Sache, bislang zahlen wir die Miete immer noch selbst.

Mein Fazit: ich kann es mir gar nicht leisten, Selfpublisher oder gar nur Hybridesse zu werden. Weder kann ich ein paar Monate für „umme“ arbeiten, noch habe ich Zeit, Energie und Nerven, die Abteilungen Vertrieb und Marketing auch noch zu ersetzen.
Ich kann es mir ergo gar nicht leisten, zu schreiben, was ich will.
Ach so: warum mein Mann nicht einfach alleine den Lebensunterhalt für die Familie verdient? Der hat leider den falschen Beruf, er ist Schriftsteller.


